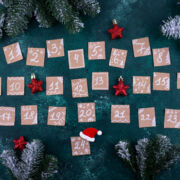Die Adventzeit ist für mich jedes Jahr ein besonderer Abschnitt – und ich bin sicher, vielen von euch geht es ähnlich. Es liegt etwas Magisches in diesen Wochen vor Weihnachten: Kerzenlicht, der Duft von Zimt, Vanille oder Tanne in der Luft, die Vorfreude, wenn man sich überlegt, mit welchen kleinen Gesten man anderen eine Freude machen könnte. Ich liebe dieses Gefühl und ich möchte es ganz bewusst genießen, statt mich von der Hektik anstecken zu lassen, die so oft im „Weihnachtsstress“ mitschwingt.
Mir hilft dabei der Blick auf das, was wirklich zählt: Achtsamkeit, Dankbarkeit – und die Freude am Schenken, jenseits von Glitzerpapier und vollen Einkaufsstraßen. Besonders schön finde ich es, wenn ich jeden Tag im Advent einen kleinen magischen Moment einbauen kann. Deshalb gibt es heuer bei uns im Bildungsinstitut einen Adventkalender, bei dem ihr jeden Tag tolle Preise gewinnen könnt. Jedes der Türchen soll nicht nur Freude bringen, sondern auch daran erinnern, wie wertvoll jeder einzelne Tag dieser besonderen Zeit ist.
Und wenn ich merke, jetzt lasse ich mich doch anstecken von all dem Weihnachtstrubel, dann gönne ich mir ganz bewusst eine Tasse Tee oder Kaffee – nicht nur nebenbei, nicht zwischen Tür und Angel, ohne gedanklich schon beim nächsten E-Mail zu sein. Ich nehme das Häferl in beide Hände, spüre die Wärme an den Fingern, beobachte den Dampf, der langsam aufsteigt, rieche die feinen Aromen, atme tief aus und nehme den ersten Schluck mit geschlossenen Augen. Dieser kurze Augenblick gehört nur mir. Und er reicht oft schon aus, um ruhiger und klarer durch den Tag zu kommen. Probiert das einmal aus: einfach innehalten, alle Sinne öffnen, atmen, schmecken, riechen, fühlen – und wieder bei sich ankommen.

Denn das ist für mich der Kern des Advents: innehalten, bewusst leben, sich Zeit nehmen. Ich versuche deshalb, frühzeitig mit allem zu beginnen, was erledigt werden muss, damit genug Raum bleibt für das, worum es wirklich geht: gemeinsame Zeit mit meinen Lieben. Und ja, ich schenke auch gerne. Aber nicht planlos oder aus Pflichtgefühl, sondern mit dem Wunsch, jemandem ein Lächeln zu entlocken.
Und Weihnachten ist natürlich auch die Zeit für gute Taten – und für die Kinder und unserem Hilfsprojekt Harambee in Kenia beginnt zu Jahresbeginn gleich das neue Schuljahr. Für 40 kleine Vierjährige beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt: die Vorschule. Einige von ihnen suchen noch eine Patin oder einen Paten, der sie begleitet und unterstützt. Das ist kein Geschenk, das man einpackt – aber eines, das ein Leben verändert.
Vielleicht möchtet ihr in diesem Jahr ein Geschenk mit Sinn machen?

In unserem Harambee-Spendenshop findet ihr schöne Möglichkeiten – und wer möchte, bekommt von uns auch eine symbolische Urkunde zum Weiterschenken. Für Menschen, die „eh schon alles haben“, kann das genau das Richtige sein. Ganz neu gibt es auch unsere Harambee-Teddys: 50 Stück stehen zum Verkauf, der Erlös geht vollständig an unser Projekt (bei Interesse: gern E-Mail an office@vonwald.at. Das Schöne daran: Jeder kleine Teddy findet gleich doppelt ein Zuhause – einer für euch oder eure Liebsten, und einer für einen unserer kenianischen Schulanfänger. Das ist wahre Weihnachtsfreude.
Ich bin überzeugt: Wenn wir den Advent nicht als Pflichtprogramm voller Termine und Erwartungen sehen, sondern als Einladung zum bewussten Leben, wird er zur echten Kraftquelle. Vielleicht hilft dir unser Adventkalender ein wenig dabei – als täglicher, liebevoller Impuls, dir selbst oder anderen etwas Gutes zu tun. Und vielleicht schenkst du dieses Jahr etwas, das weiterwirkt. Wissen in Form einer Ausbildung oder einer Kursbox für einen lieben Menschen oder Schulbildung für ein Kind, das sonst keine Möglichkeit dazu hätte.
Ich wünsche euch von Herzen eine entspannte, achtsame, zauberhafte Adventzeit!
Bis bald, herzliche Grüße
Sarah Eidler